»Chaos auf dem Lustschloss« klingt zwar wie ein 70er-Porno-Titel, fasst G. E. Lessings »Emilia Galotti« aber sehr gut zusammen:
Wenn der Stalker-Prinz an seinen First World-Problems zugrunde geht; Emmis Rolle daraus besteht, den Mund verboten zu bekommen und sich eigentlich alle nur flauschige Murmeltiere zähmen wollen, behalten wohl nur Gräfin Orsina und Mutti den Überblick.
So ganz kam niemand aus der Crew in seinem Leben an »Emilia« vorbei. Zu Recht ein Lehrplan-Dauerbrenner?


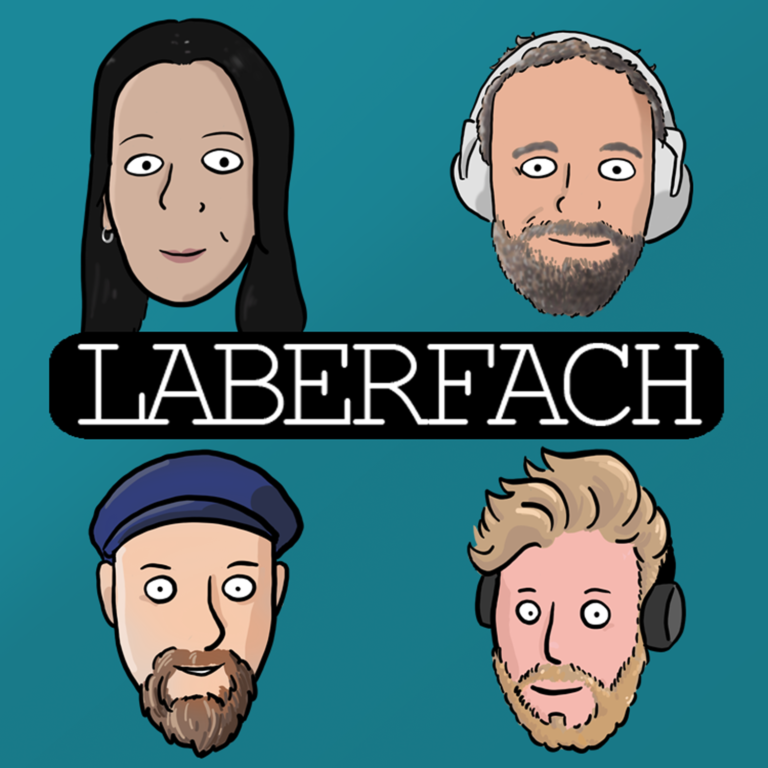
7 Antworten auf „#47: Gotthold Ephraim Lessing – Emilia Galotti“
wollte mal ganz vorsichtig anmerken, dass:
– die galottis keinesfalls bürgertum sind, sie sind immerhin hoffähig
– es bei lessing im bürgerlichen trauerspiel [den zusatz hat er selber wieder entfernt, da für ihn ein trauerspiel immer bürgerlich ist – siehe: das theater des hernn diderot] nie um den konflikt adel – bürgertum geht, bürgerlich ist hier nämlich keine soziologische kategorie, sondern wäre am besten mit dem wort familiär/die familie betreffend, zu übersetzen: wenn es diesen konflik hier gäbe, müsste er ja am ehesten durch die heirat emilias mit graf appiani entstehen – was aber nicht der fall ist. die einschätzung als missbündnis stammt ja von marinelli. der hat aber mit appiani eine eigene rechnung offen – was der prinz auch sogleich anmerkt.
– lessing niemals pars pro toto einer schicht oder klasse als ganzes bestimmte positive/negative eigenschaften zuschreiben würde (zumidest wenn es um charaktere und nicht um typen geht)
– es DAS bürgerliche trauespiel bei lessing überhaupt nicht gibt (miss sara sampson funktioniert ganz anders als emilia und diese beiden wieder komplett anders als z.b kabale und liebe – siehe: hamburgische dramaturgie + albert meier, monika fick, gisbert ter nidden)
habe den podcast leider nur bis zu dem punkt gehört, als der junge mann sagte, er kenne ja bürgerliche trauerspiele, die sind halt alle gleich.
liebe grüße, jens.
Dennoch wird Emilia Galotti als Muster DES bürgerlichen Trauerspiels überhaupt rezipiert, als Werk, das das Genre und die Literatur danach geprägt hat, was auch seinen Grund hat:
Lessing zeichnet einen ganz klaren Gegensatz zwischen der Familie Galotti, der er bürgerliche Werte zurechnet, und der höfischen Sphäre, der er konträre Eigenschaften zuweist (und die z.B. Vater Galotti laut und kategorisch ablehnt).
Es ist ähnlich wie mit Goethes „Faust“: Die Handlung ist im Mittelalter angesiedelt, trotzdem weist Goethe (aus seinem gesellschaftlichen und historischen Verständnis heraus) Gretchen ganz klar bürgerliche Werte zu (was die Germanistik x-fach diskutiert hat), obwohl das Bürgertum im Mittelalter noch gar nicht existierte.
Und die große Ähnlichkeit der bürgerlichen Trauerspiele halte ich auch nicht für aus der Luft gegriffen: Tochter tot, Vater schuld… 🙈
naja, schade.
ich dachte, es gäbe hier die möglichkeit einer konstruktiven unterhaltung. aber wenn DIE germanistik das x – fach diskutiert hat. dann is ja gut, dass da alles geklärt wurde und kein wölkchen den horizont trübt.
auch schade halt für schüler*innen, die mal woanders als in den köngis-erläuterungen nachgelesen haben und wissen wollen, was es damit auf sich hat.
draußen, jens.
In der Literaturwissenschaft wurde immer wieder nachgedacht, warum Gretchen lange als Aushängeschild des Bürgertums rezipiert wurde, obwohl es das im Mittelalter gar nicht gab. Das schrieb ich.
Eine Diskussion wollte ich nicht abwürgen!
was mich als nicht-germanisten immer irritiert, ist, dass man im schulischen betrieb des armen lessings wundervolle sara und emilia mit macht unter das bürgerliche trauerspiel zwingen will, obwohl er selbst das ganz anders sieht (brief an nicolai; das theater des herrn diderot; hamburgische dramaturgie, dort speziell seine auslegung der aristotelischen katharsistheorie). und auch im universitären betrieb mindestens die drei schon oben erwähnten doch einen anderen ansatz vorschlagen.
aber das ist vermutlich mein ganz persönlicher hau. (ich finde z. b. auch die hochgelobten physiker von dürrenmatt eher schlecht. ;))
Ich kann verstehen, woher der Impuls kommt. Odoardos Frust-Reden über den Prinzen könnte genauso gut Miller aus „Kabale und Liebe“ herausgehauen haben.
Ich verstehe aber auch deine Kritik, dass die Zuordnung häufig zu kurzgegriffen ist. Auch wenn mir Lessings Autoren-Intention dabei herzlich egal ist – es stimmt, was du sagst: Der harte Ständeunterschied ist bei „Emilia“ (ihre Mutter ohnehin adelshörig, ihr Vater best friends mit Appiani, wie du richtig sagst: hoffähig) lange nicht so schwarz-weiß gezeichnet wie eben etwa bei Schiller.
Die Einordnungsdebatte lohnt im Unterricht 👍🏻
alles klar, danke.